BMF konkretisiert Eckpunkte der E‑Rechnung B2B in Deutschland
Das Gesetz zur Einführung der E‑Rechnungs-Pflicht in Deutschland (siehe Wachstumschancengesetz Artikel 23 und 24) ist seit dem 1.1.2025 in Kraft.
Mit dem ersten Schreiben vom 15. Oktober 2024 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zentrale Eckpunkte für die Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei inländischen B2B-Umsätzen konkretisiert.
Inzwischen hat das BMF das ursprüngliche Schreiben inhaltlich überarbeitet und am 15. Oktober 2025 veröffentlicht. Perspektivisch sollen diese Inhalte in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) überführt werden.
In dem nachfolgenden Beitrag erhalten Sie einen Überblick über die entscheidenden Punkte aus beiden Veröffentlichungen des BMF.
Wie konkretisiert das BMF das Gesetz zur Einführung der E‑Rechnung?
Auf welche Aspekte geht das BMF in seinem Schreiben vom 15.10.2024 ein?
Diese wurden zur Klarstellung der gesetzlichen Grundlage – dem Wachstumschancengesetz Artikel 23 + 24 – und die Anwendung in der Praxis veröffentlicht.
Die Kernfragen aus dem BMF-Schreiben (15.10.2024)
Als Leserin bzw. Leser dieses Beitrages möchten Sie sicher erfahren, wie Sie die E‑Rechnung in der Praxis umsetzen.
Alle wichtigen Eckpunkte aus dem Schreiben des BMF haben wir hier für Sie in Form von Fragen und Antworten zusammengetragen.
Fragen und Antworten zur Einführung der E‑Rechnung in Deutschland
Wie ist die Annahmepflicht für E‑Rechnung auf Basis der EN 16931-Spezifikation umzusetzen?
Eine Verweigerung, weil man nicht in der Lage ist diese elektronisch zu verarbeiten oder schlichtweg keine E‑Rechnungen haben möchte, ist nicht zulässig.
Im Falle einer Verweigerung ist es Aufgabe der Parteien (Kunde & Lieferant) sich zivilrechtlich zu einigen.
Der Anspruch auf Annahme einer E‑Rechnung kann gerichtlich durchgesetzt werden.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 26, 40, 42, 43
Welche Formate einer E‑Rechnung sind zulässig bzw. müssen angenommen werden?
- In Deutschland fallen darunter z. B. die Formate XRechnung und ZUGFeRD.
Da beim Format XRechnung immer die aktuelle Version zu verwenden ist, ist genau auch diese zulässig.
Bei ZUGFeRD ist auf die verwendete Version (mindestens 2.0.1) und das genutzte Profil (nicht MINIMUM, nicht BASIC WL) zu achten. Die erstellte E‑Rechnung muss die Anforderungen aus der EN 16931-Spezifikation erfüllen. - Zusätzlich sind auch andere EN 16931-konforme Formate, die z.B. im Ausland gebräuchlich sind, zulässig.
Es müssen also alle EN 16931-konformen Formate angenommen werden. Als Beispiel werden die französiche Factur‑X und Peppol-BIS Billing konkret erwähnt.
Des Weiteren stellt das Schreiben klar, das Versender und Empfänger sich auf ein favorisiertes Format einigen können. Im Zweifel hat jedoch der Versender die Wahlfreiheit.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 24, 27
Wie ist die Zustimmung zum Empfang einer “sonstigen elektronischen Rechnung” einzuholen?
“Sonstige E‑Rechnungen” sind dabei z.B.
- einfache PDFs ohne strukturierte Daten
- ZUGFeRD, die nicht der EN 16931-Spezifikation entspricht (alte Version, Profil oder fehlerhafte Validierung)
- EDIFACT, VDAXXX und ähnliche Formate
Die Zustimmung zur sonstigen E‑Rechnung kann formlos erfolgen. Eine explizite schriftliche Vereinbarung ist nicht zwingend erforderlich.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 20
Wie passt sich die EU-Norm EN 16931 auf die Bedürfnisse der E‑Rechnung zwischen Unternehmen (B2B) an?
Eins ist klar:
- Die Norm entwickelt sich stetig weiter.
- Konkret in Arbeit ist die Anpassung der Kernfelder im Hinblick auf die B2B-Anforderungen durch das technische Komitee (CEN).
Für alle Beteiligten wird es im Falle von Änderungen ausreichend Zeit geben diese umzusetzen. Beispielsweise sind nach der geplanten Anpassung der Kernfelder zwei Jahre Vorlaufzeit vorgesehen, bevor diese final berücksichtigt werden müssen.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 28, 29
Was bedeutet gesetzliche Anforderung zur Lesbarkeit von E‑Rechnungen?
Ein Sichtdokument ist nicht erforderlich.
Eine ZUGFeRD Rechnung bringt ihr Sichtdokument als Buchungshilfe mit.
Für die Visualisierung einer XRechnung bzw. der strukturierten Daten einer ZUGFeRD verweist das Schreiben auf Technologien mit deren Hilfe Rechnungsdaten visualisiert werden können.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 5, 6
Welche Übermittlungswege sind laut BMF zulässig?
Als Übermittlungsweg können folgende Optionen verwendet werden:
- E‑Mail
- Schnittstelle (z. B. WebService)
- Download (z. B. SFTP)
- über Dienstleister (über o. g. Übermittlungswege oder via Peppol)
- über ext. Speichermedium
Für den Empfang von E‑Rechnungen reicht heute die Bereitstellung eines E‑Mail-Postfachs grundsätzlich aus.
Dabei muss das E‑Mail-Postfach nicht dediziert für den Empfang von E‑Rechnung reserviert sein.
Das BMF weist darauf hin, dass E‑Mail als Übertragungsweg für den Austausch von Rechnungsdaten im Rahmen des geplanten Steuermeldesystems perspektivisch ggf. nicht mehr zulässig sein wird.
Hier erwartet das BMF, dass E‑Rechnungsplattformen von Bedeutung sein werden. Weitere Details werden im Rahmen der Gestaltung des Meldesystems festgelegt.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 36–40, 41
Welche Rolle spielen “Interoperable Formate” für E‑Rechnungen nach 1.1.2028?
- der EU-Norm 16931 entsprechen und eine der erlaubten Syntaxen (CII oder UBL) verwenden muss oder
- auf Basis eines zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbartes Format.
Dabei ist entscheidend, dass die Umsatzsteuerrechtlichen Mindestangaben aus der E‑Rechnung oder einem interoperablen Format möglich sind.
Ein interoperables Format kann mit Zustimmung des Empfängers auch über den 1.1.2028 hinaus eingesetzt werden,
- wenn der Empfänger damit einverstanden ist,
- alle laut EN 16931-Spezifikation geforderten Daten enthalten sind und
- dieses direkt über ein Mapping in eine EN 16931-konforme E‑Rechnung transferierbar ist.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 4
Diese Regelung zielt auf den Bestandsschutz von EDI-Formaten wie z.B. EDIFACT ab.
Was ist bei der Angabe von Leistungen innerhalb einer E‑Rechnung zu beachten?
Zudem bedeutet es, dass rechnungsbegründende Anlagen mit Relevanz für den Vorsteuerabzug (z.B. Stundennachweise) ebenfalls im strukturierten Teil der Rechnung enthalten sein müssen. Dies erfolgt durch Einbettung (z.B. einer Excel-Datei) im XML. Dazu wird diese mithilfe des BASE64-Algorithmus in eine ASCII-Zeichenkette umgewandelt. Auf Empfängerseite müssen diese Anhänge durch Decodieren wieder in ihr ursprüngliches Format gebracht werden.
Zusätzliche Informationen, die dem Empfänger nur zur Rechnungsprüfung dienen und sonst nicht steuerlich relevant sind, können und dürfen in einem separaten Anhang mitgeschickt werden. Dieser gehört dann nicht zur Rechnung und muss auch nicht mit archiviert werden.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 35
Wie sind Verträge im Kontext der E‑Rechnung zu behandeln?
Das BMF konkretisiert. Eine E‑Rechnung muss erst dann gestellt werden, wenn sich etwas ändert. Also z.B. nach einer Mieterhöhung.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 45
Wer prüft eigentlich, ob die Übergangsregelung noch angewendet werden darf?
Ist man als Rechnungsempfänger einer PDF oder Papierrechnung verpflichtet zu prüfen, ob der Versender dazu berechtigt war. Das wird z.B. relevant, wenn Unternehmen ein drittes Jahr lang einfache PDF-Rechnungen ohne strukturierte Daten versenden. Das dürfen sie, wenn sie weniger als 800.000 Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2026 zu verzeichnen hatten.
Das BMF stellt hier klar, dass Rechnungsempfänger anhand vorliegender Informationen auf die Inanspruchnahme vertrauen dürfen. Es wird erwartet, dass bekannte Fakten und Kenntnisse dabei berücksichtigt werden.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 13, 59
In welchen Sonderfällen ist auch eine E‑Rechnung verpflichtend auszustellen?
- ein deutsches Unternehmen etwas an die Betriebsstätte eines anderen deutschen Unternehmens im Ausland liefert
- es sich nach § 4 Nummer 1 bis 7 UStG um eine steuerfreie Leistung bzw. Lieferung handelt, unter Beachtung der übrigen Voraussetzungen einer E‑Rechnung.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 13
Welche Änderungen für die E‑Rechnung werden im Kontext der geplanten Meldeplattform erwartet?
Die technisch möglichen und rechtlich zulässigen Übertragungswege werden im Rahmen des Meldesystems neu zu definieren sein.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 41
Wie lässt sich mit der E‑Rechnung eine Endrechnung erstellen?
Eine Endrechnung erfordert, dass die einzelnen Mehrwertsteuer-Beträge der Anzahlungsrechnung und aller Teilrechnungen aufgeführt werden.
Die Felder, die dafür benötigt werden, sind allerdings nicht in den Kernfeldern zu finden, sondern in den Erweiterungen (auch Extensions genannt).
Das bedeutet, dass bei einer ZUGFeRD-Rechnung das Profil Extended zu verwenden ist. Das ist deutlich komplexer, als die Ausstellung einer einfachen ZUGFeRD-Rechnung. Bei einer XRechnung gelingt das ebenfalls durch Verwendung der Erweiterungen.
Der Vorschlag des BMF ist an der Stelle, alternativ zu einer Endrechnung, eine Restrechnung zu stellen.
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffern 47, 48
Im Falle einer Restrechnung werden referenzierte Rechnungen im besten Fall als Anhang beigefügt.
Eine Prüfung des kompletten Sachverhaltes erfordert i. d. R. einen manuellen Aufwand.
Je nach Komplexität bzw. Projektumfang kann das viel Zeit kosten und zudem fehleranfällig sein.
Der Vorteil einer Endrechnung ist die mögliche automatisierte Prüfung aller Daten auf Seite des Empfängers.
Das wird durch die Abbildung aller Daten in strukturierter Form ermöglicht.
Eine Endrechnung bietet daher die perfekte Basis für eine systemgestützt gar automatisierte Rechnungseingangsprüfung.
Was ist für den Vorsteuerabzug bei hybriden E‑Rechnungen (z.B. ZUGFeRD) zu beachten?
- Wenn der Bildteil keine abweichenden Daten nach §14 UStG enthält, gilt er als inhaltlich identisches Mehrstück.
- Weichen Bildteil und strukturierte Daten voneinander ab, stellt dieser Teil ggf. eine weitere (sonstige) Rechnung dar. Kleinere Abweichungen zwischen beiden Teilen wie geringfügige Abweichungen oder eine kürzere Schreibweise, werden toleriert.
Grundsätzlich gilt:
- Der Vorsteuerabzug ist nur aus dem strukturierten Teil der E‑Rechnung möglich.
Hier ist Vorsicht geboten!
Speziell bei hybriden Formaten wie ZUGFeRD (diese bestehen aus Sichtdokument = PDF und XML-Datei = strukturierte Daten), wenn PDF und XML-Datei voneinander abweichen.
Relevant für den Vorsteuerabzug ist in Deutschland lediglich, was in den XML-Daten steht!
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.10.2024 – Ziffer 32
Das BMF hat im finalen Schreiben vom Oktober 2025 u.a. den Umsatzsteuer-Anwendungserlass überarbeitet.
Hier gibt es ergänzend alle wichtigen Änderungen zu dem Schreiben des BMF in Form von Fragen und Antworten.
Fragen und Antworten zur Einführung der E‑Rechnung in Deutschland auf Basis vom BMF-Schreiben (15.10.2025).
Die Ergänzung des BMF-Schreibens vom 15. Oktober 2025 bringt weitere Klarstellungen zum ursprünglichen Schreiben vom 15. Oktober 2024.
Wie genau ist das mit der Empfängerzustimmung zu verstehen?
Quelle: Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (vom 15.10.2025) – Seite 10 von 33 (7)
Was passiert bei einer fehlerhaften E‑Rechnung?
Andernfalls liegt hier eine sonstige elektronische Rechnung vor.
Der Empfänger kann, sofern keine gesetzliche Pflicht zur E‑Rechnung vorliegt, die Rechnung als sonstige Rechnung annehmen oder ablehnen.
Das BMF stellt klar: Ein Vorsteuerabzug ist nur aus dem strukturierten Teil der E‑Rechnung möglich.
Bei hybriden Rechnungen wie ZUGFeRD zählt ausschließlich der XML-Teil. Weichen PDF und XML voneinander ab, kann das PDF u. U. als zusätzliche Rechnung gelten.
Ist die PDF einer hybriden E‑Rechnung (z.B. ZUGFeRD) defekt, gilt im Falle einer weiterhin auslesbaren XML die E‑Rechnung immer noch als gültig.
Bei kritischen Fehlern – z. B. bei fehlender Steuernummer oder fehlerhaften Beträgen – droht der Verlust des Vorsteuerabzugs.
Quelle: Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (vom 15.10.2025) – Seite 27 von 33 (4a)
Zudem empfiehlt das BMF zur Sicherstellung des korrekten Versandes von E‑Rechnung die Verwendung einer entsprechenden Validierungsanwendung.
Quelle: Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (vom 15.10.2025) – Seite 31 von 33 (f > aa)
Wie erfolgt der Nachweis der Zustellung bei einer E‑Rechnung?
Quelle: Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (vom 15.10.2025) – Seite 9 von 33 (5)
Das BMF betont nochmal
- E‑Rechnungen müssen alle Pflichtangaben im strukturierten Teil enthalten – Anhänge oder Links sind nicht ausreichend.
- E‑Rechnungen sind auch bei Gutschriften, Reverse-Charge-Fällen, Reiseleistungen, landwirtschaftlicher Durchschnittssatzbesteuerung etc. verpflichtend.
- Aufbewahrungspflichten: Der strukturierte Teil der E‑Rechnung muss im Originalzustand archiviert werden. Eine GoBD-konforme Archivierung ist für Umsatzsteuerzwecke nicht zwingend.
Fragen oder Diskussionsbedarf zur E‑Rechnung B2B?
Bei Fragen zu den aktuellen Entwicklungen nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Fragen Sie dabei gerne nach einem Gesprächstermin mit Tim Roßky (Geschäftsführer Cegedim e‑Business GmbH und Mitglied im Vorstand des Verband elektronische Rechnung) oder kommen Sie einfach zum nächsten Live-Webinar.
Wir bleiben für Sie dran und informieren Sie über jeden weiteren Schritt hier, auf LinkedIn und im nächsten Webinar.
- Rund um die Einführung der E‑Rechnung in Deutschland,
- zu allen Themen rund um das geplante einheitliche elektronische Steuermeldesystem und
- wie Sie den Umstieg auf die E‑Rechnung erfolgreich meistern.
Fragen oder Diskussionsbedarf zur E‑Rechnung B2B?
Bei Fragen zu den aktuellen Entwicklungen vereinbaren Sie einfach einen passenden kostenlosen Gesprächstermin mit Tim Roßky (Geschäftsführer Cegedim e‑Business GmbH und Mitglied im Vorstand des Verband elektronische Rechnung) oder kommen Sie einfach zum nächsten Live-Webinar.
Wir bleiben für Sie dran und informieren Sie über jeden weiteren Schritt hier, auf LinkedIn und im nächsten Webinar.
- zur Einführung der E‑Rechnungs-Pflicht in Deutschland,
- zu allen Themen rund um das geplante einheitliche elektronische Steuermeldesystem und
- wie Sie den Umstieg auf die E‑Rechnung erfolgreich meistern.
Noch mehr rund um E‑Rechnung, Clearance & Co.:
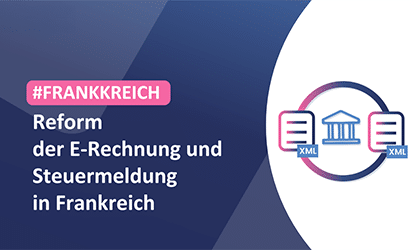
Reform der E‑Rechnung in Frankreich
Clearance/Tax-ReportingE‑Rechnung
Die Reform der E‑Rechnung in Frankreich nimmt Fahrt auf. Je nach Unternehmensgröße kommt die E‑Rechnungs-Pflicht ab September 2026.
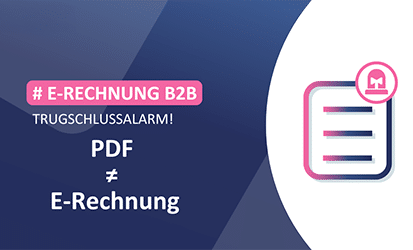
Was unterscheidet eine PDF-Rechnung von einer »echten« E‑Rechnung?
Digitale ExpertiseE‑Rechnung
O‑Ton aus einem kürzlichen Gespräch: “Wir versenden schon 80% unserer Rechnungen elektronisch als PDF. Da sind wir bestens vorbereitet auf die E‑Rechnung … oder etwa nicht?

Gesetz zur E‑Rechnungspflicht in Deutschland final verabschiedet
Digitale ExpertiseE‑Rechnung
Einführung der E‑Rechnungspflicht wurde vom Bundesrat beschlossen. Verschaffen Sie sich einen Überblick zu den Übergangsfristen, Ausnahmen und Co.
